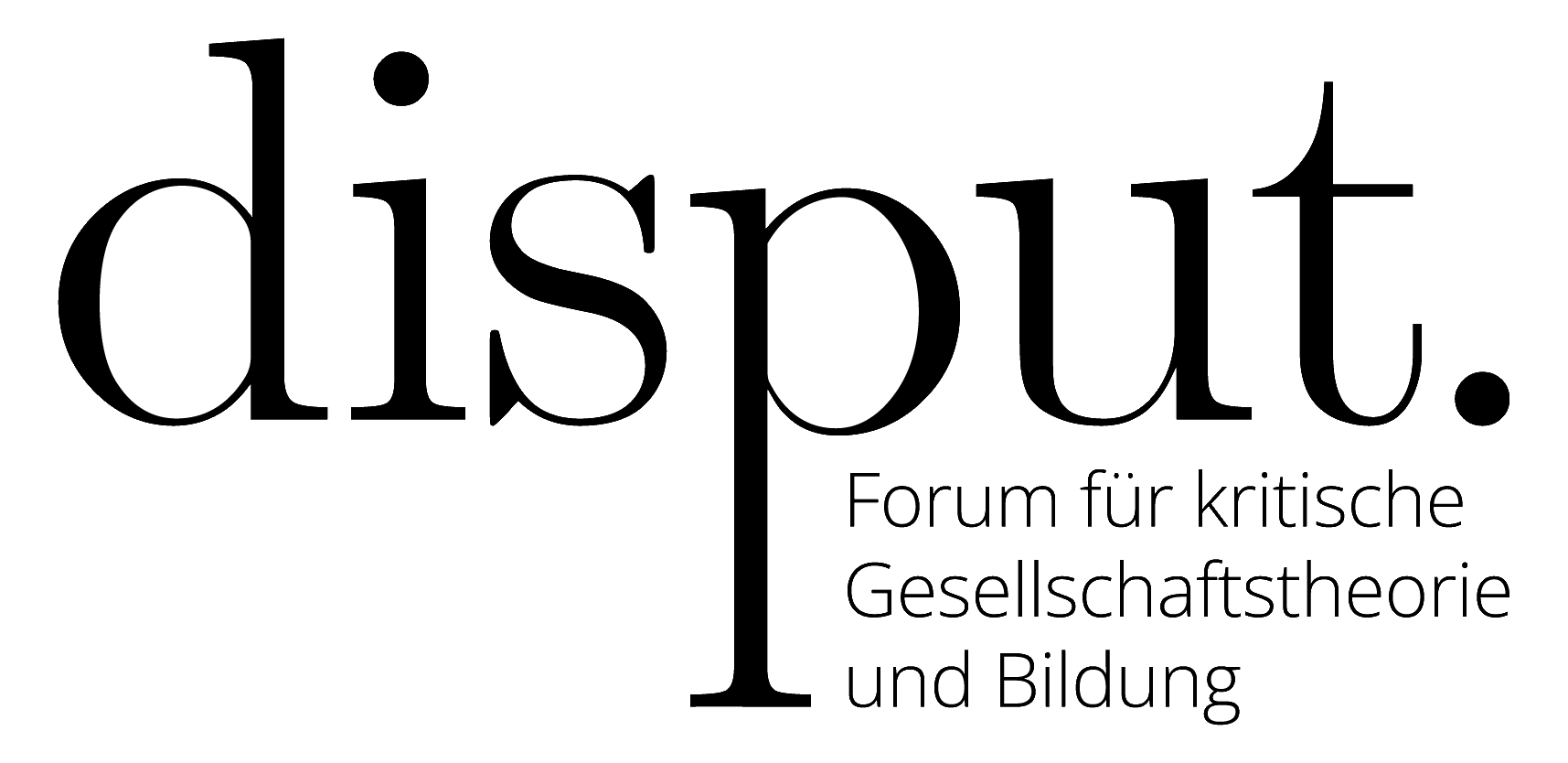- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Alle reden vom Krieg – wir auch | Redaktion Distanz Magazin
14. Oktober 2025 , 19:00 – 21:00
Das Distanz Magazin stellt die 8. Ausgabe zum Thema „Krieg und Frieden“ vor. Heinrich Hofer und Julian K.-Duschek diskutieren ihre Beiträge im Heft und skizzieren eine Kritik an Krieg und Konformismus. Dabei versuchen sie, die Distanz zum allgegenwärtigen Positionierungszwang aufrecht zu erhalten, der selbst Ausdruck des Krieges ist.
»Krieg und Frieden« klang für die meisten lange Zeit nach einem banalen Gegensatz, der in der Alltagssprache kaum einer näheren Bestimmung bedurfte. Die Forderung nach Frieden war lange Zeit so mainstream, dass man mit Krieg- und Gewaltaffirmation regelrecht edgy und rebellisch sein konnte – und sich damit vielleicht sogar im Positionierungszwang eine fruchtbare Nische erkämpfte. »Bomber Harris do it again« war eine schonungslose Provokation mit einem schmerzenden Augenzwinkern, eine Zuspitzung von Paul Spiegels »Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder«, und wollte darauf hinweisen, dass es noch Schlimmeres geben kann als organisierte Massengewalt zwischen zwei Gruppen. Trotzdem bauen manche ihren radikalen Pazifismus mitunter zum Lebensstil aus und übersehen dabei, dass unser politisch-ökonomisches Miteinander und Gegeneinander in erster Linie das Ergebnis von vertraglich fixierter Gewalt ist, deren permanente Androhung eine inhumane Ordnung aufrechterhält. Andere rechtfertigen dagegen bis in die Gegenwart Militäreinsätze »wegen Auschwitz« und ignorieren dabei häufig den latenten Kriegszustand, in dem sich die Staaten nach außen dauerhaft gegenüberstehen. Dem entspricht auch, dass man oft gar nicht so richtig sagen kann, was Frieden eigentlich ist, und so wird der Begriff einfach als Abwesenheit bzw. Gegensatz von Krieg definiert, lässt sich also ohne eine Vorstellung von Krieg gar nicht denken. In dieser negativen Bestimmung, die es so schwer macht, über Frieden zu schreiben, ohne Krieg zu erwähnen, könnte aber auch das utopische Potenzial dieser Vorstellung liegen: Frieden meint einen Zustand, dessen nähere Bestimmung immer wieder neu und in Abgrenzung zum erfahrenen gesellschaftlichen Leid gewonnen werden muss und sich deshalb vielleicht nie positiv bestimmen lässt.
Seit 2022 – und eben nicht schon seit 2014 – hört man plötzlich allerorts die Rede von einer »Rückkehr des Kalten Krieges« sowie einem »Ende der Friedensdividende«. Ob mit Blick auf den Kalten Krieg oder – wie die Formulierung vom »russischen Vernichtungskrieg« es ausdrückt – auf den Zweiten Weltkrieg, meistens wird dabei versucht, einen erneuten Anschluss der Gegenwart an die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts herzustellen. Distanz Nr. 8 versucht, einen Blick auf Krieg und die diesem zugrundeliegenden Verhältnisse zu werfen, ohne sich eine feste Ahnung davon anzumaßen, wohin der Zerfall der gegenwärtigen Weltordnung führen wird.
Zur Aufdeckung der vielfältigen Verdeckungszusammenhänge ist es manchmal nötig, ein paar Schritte zurückzugehen, um wieder nach vorne schauen zu können. So setzt sich Heinrich Hofer in seinem Beitrag mit der Kriegsphilosophie von Heraklit und Clausewitz auseinander, um an diesen die Fallstricke des Nachdenkens über den Krieg zu diskutieren. Dabei zeigt er, wie deren Ansätze dennoch dabei helfen können, das Verhältnis von Krieg und Gesellschaft zu erhellen sowie die immanente Verselbständigungstendenz des Krieges einzuordnen.
Die Transformation des allgegenwärtigen Gewaltverhältnisses im Kapitalismus zeichnet auch Julian K.-Duschek nach, der seine Serie über den ›bellum omnium contra omnes‹, den Krieg aller gegen alle, fortführt. In der Epoche des Imperialismus wird dieses Verhältnis verdinglicht und avanciert zum internationalen Machtkampf zwischen den Staaten, während es innerhalb dieser repressiv befriedet wird.
Das Distanz-Magazin, ursprünglich 2015 als Onlinemagazin in Bamberg gegründet, erscheint seit 2021 nicht nur in deutlich größerem Umfang, sondern auch als Printausgabe. Schwerpunkt und Ziel des Magazins ist eine Gesellschaftskritik, die sich ausgehend vom Individuum nicht in Theorie und Bescheidwissen verliert, sondern grundsätzlich unabgeschlossen und offen bleibt, solange der Maßstab unserer Kritik, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (Marx), nicht erfüllt ist.