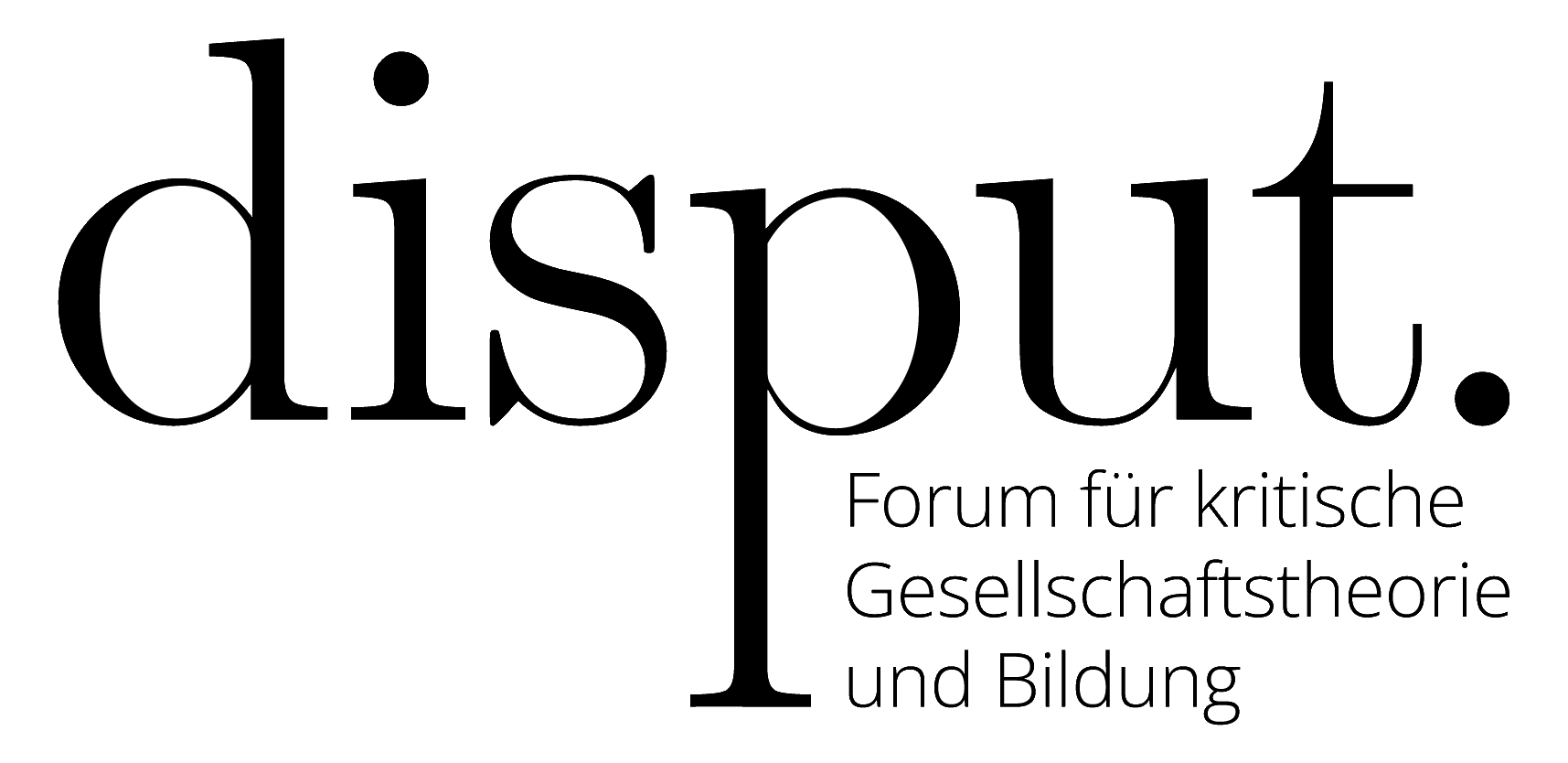1. Juli 2025 | Minze Maraffa: Die ‚Krise der Kritik‘ oder die ‚Krise des Kritikers‘? Die Form der Kritik im Neoliberalismus
Der zentrale Begriff dieses Vortrags ist Kritik. Darunter verstehe ich eine Praxis, welche durch die Analyse und Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse die Möglichkeit von gesellschaftlicher Veränderung aufzuzeigen und im besten Falle diese Veränderung zu unterstützen versucht. Im Rahmen meiner Masterarbeit interessiert mich, wie Kritik aussehen müsste, die der aktuellen Zeit angemessen ist. Dafür gehe ich in drei Schritten vor: Erstens untersuche ich, wie in aktuellen Debatten die Frage nach der Kritik behandelt wird. Es zeigen sich verschiedene Positionen, welche jedoch alle unter dem Vorzeichen einer ‚Krise der Kritik‘ verstanden werden können: Im Neoliberalismus scheint die Grundlage für Kritik zu schwinden. Dieser Tatbestand begründet die Hypothese, dass die Form, in der sich Kritik äußern kann, von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängt. Deshalb rekonstruiere ich im zweiten Schritt schlaglichtartig, wie verschiedene Autoren (Marx, Horkheimer, Adorno) im Lichte ihrer Zeit auf die adäquate Form der Kritik reflektiert haben. Dadurch erhoffe ich mir eine Skizze des Verhältnisses von der Form der Kritik zu ihren gesellschaftlichen Verhältnissen. Schließlich möchte ich im dritten Schritt in das Denken und Schreiben von Ilse Bindseil einführen, um zu untersuchen, inwiefern Bindseil eine adäqute Form der Kritik im Neoliberalismus gefunden hat.
9. September 2025 | Leo Elser: Der Traum vom Frieden. Warum die Zweistaatenlösung unter den gegebenen Umständen keine Lösung ist und der Palästina-Aktivismus den Palästinensern nicht hilft
Die Rede von einer Zweistaatenlösung geht von der Annahme aus, dass die regelmäßigen Kriege im Nahen Osten enden würden, wenn neben dem bereits existierenden Staat Israel ein palästinensischer Staat entsteht. Aus mehreren Gründen ist diese Annahme keineswegs unmittelbar einleuchtend. So ist die Oberfläche der Erdkugel nahezu vollständig in Staaten aufgeteilt, ohne dass deswegen der Weltfrieden ausgebrochen ist. Offenkundig garantiert Staatlichkeit alleine noch lange keinen Frieden. Auch abstrahiert die Rede von der Zweistaatenlösung von den weiteren Akteuren neben Israel und den Palästinenserorganisationen: der Hisbollah im Südlibanon, Katar und natürlich dem Iran, der schon lange vor dem jüngsten Krieg die Vernichtung Israels zum Staatsziel erklärt und seine aggressive Außenpolitik in der gesamten Region vom Jemen über den Irak nach Syrien bis in den Libanon und den Gazastreifen mit Milizen und Terrororganisationen gewaltsam durchzusetzen versucht.
Nicht zuletzt lehnt der Kriegsgegner Israels, die Hamas, nicht nur die Zweistaatenlösung ab, sondern lehnt es überhaupt ab mit Israel auch nur über einen Quadratzentimeter Land zu verhandeln. Die Hamas ist aber dank der Unterstützung Katars und Irans bislang die herrschende Macht im Gazastreifen gewesen.
Leo Elser ist Autor und Redakteur der Zeitschrift Pólemos, deren jüngste Ausgabe unter dem Titel „Verteidigt Israel“ erschienen ist. Dort schrieb der Referent über die Zweistaatenlösung. Dieser und weitere Artikel werden im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt.
Zeitschrift Pólemos: www.kritischetheorie.wordpress.com
Wer also ernsthaft die Zweistaatenlösung fordert und behauptet, sie wäre ein Schritt zum Frieden, müsste sich auch mit den Voraussetzungen beschäftigen, die gegeben sein müssten, damit überhaupt sinnvoll von einem „palästinensischen Staat“ gesprochen werden kann und ebenso mit den Voraussetzungen, die gegeben sein müssten, damit ein solcher Staat eine einigermaßen realistische Option auf eine friedliche Koexistenz mit Israel bieten könnte.
23. Oktober 2025 | David Luys: How dare you? Autopsie der Klimabewegung
Die Klimabewegung ist mausetot. Eben noch bestimmte der Schulstreik für das Klima den Stundenplan so manches Schülers, das Boulevard polterte tagtäglich gegen die „Klimakleber“ und in Gefangenensammelstellen wimmelte es an einigen Wochenenden von Aktivistinnen in weißen Malerkitteln. Und heute? Freitag ist ein Schultag wie jeder andere, für das urbane Verkehrschaos gibt es ganz andere Gründe und die Zeiten der Massenaktionen von Ende Gelände sind lange vorbei. Die Welt dreht sich weiter.
Die Klimabewegten waren sich lange sicher, das einzig richtige zu tun: die betonte Dringlichkeit, die braven Gespräche mit Klimawissenschaftlerinnen, die immergleichen Demonstrationen. Man hielt den Staat für ein Instrument, das es bloß richtig zu stimmen gilt. Appelle, Proteste, moralistische Reden und sogar ein Hungerstreik waren die Waffen der Wahl, um Politiker vom eigenen Ansinnen zu überzeugen. Als all das versagte, blieb nichts – nur der Rückzug in Vereinzelung oder Wahnsinn.
Die Katastrophe, vor der man zu Recht warnte, beginnt indes, ihre volle Wirkung zu entfalten – allerdings nicht aus kaltherziger Ignoranz, nicht aus stumpfer Unwissenheit, sondern mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses.
Am rosaroten Selbstbild der einstigen Aktivisten beginnt ein Zweifel zu nagen: Was, wenn das Scheitern nicht bloß tragisch war – sondern unausweichlich?
5. November 2025 | Peter Kern: Zum Begriff der Natur, der Ökologie, der beschädigten Subjektivität. Die Kritische Theorie des Karl Heinz Haag
Der Vortrag behandelt den Begriff der Naturwissenschaft, wie er für die Kritische Theorie schulbildend war. Adorno und Horkheimer sahen sie eingepasst in die von ihnen beschriebene, verhängnisvolle Dialektik der Aufklärung. Karl Heinz Haag untersucht die Methodik der physikalischen Wissenschaften und sein Begriff ist präziser. Im Labor und unter dem Experiment wird Natur zu einer von Masse, Ausdehnung, Geschwindigkeit und Energie bestimmten Größe. Dass dies die ganze Natur sei, folgt nicht aus den Lehrsätzen der Physik oder der Chemie, sondern aus denen der modernen, nachmetaphysischen Philosophien. Für diese gilt unumstößlich: Um Naturprozesse zu begreifen, reichen die Naturgesetze völlig aus.
Haags an Kants Vernunftkritik anschließende erkenntnistheoretische Reflexion fördert dagegen hervor: Damit ein Organismus entsteht, sind zueinander passende Stoffe und Gesetze verlangt, aber diese Koordination bewirken die materiellen Stoffe und die beteiligten Naturgesetze nicht aus sich selbst. Sie unterliegen einer Zwecksetzung, einem organisierenden Telos, sonst wäre die lebendige Natur bloß die Summe ihrer Teile. Naturprozesse haben ihren verursachenden Grund in einer naturwissenschaftlich nicht fixierbaren Dimension. Diese Dimension auszublenden, Natur positivistisch, wesenlos zu denken, ist irrational. Das systemtheoretische Paradigma der selbstreferentiellen Natur, das im Zufall die Verursachung komplexer Systeme sieht, ist die ideengeschichtlich letzte Ausprägung dieser Irrationalität.
Haags Beitrag zur Kritischen Theorie formuliert den völligen Widerspruch zu den heute vorherrschenden nachmetaphysischen Philosophien. Deren Axiom von der wesenlosen Natur steht am Anfang der bürgerlichen Weltauffassung. Der Glaubenssatz entzieht der Kritik, was für die ökologischen Katastrophen der Gegenwart ursächlich ist: Die ins Maßlose gesteigerte Naturbeherrschung. Auch die Menschen gelten diesem Positivismus für wesenlos – die kommode Anthropologie der kapitalistischen Gesellschaft. In ihr erfährt Individualität ihre große Feier, aber die vereinzelten, in Konkurrenz zueinander gestellten Subjekte sind in Wahrheit völlig depotenziert. Haag: „In einer wesenlosen Welt nehmen die wesenlosen Subjekte sich selber für ihren eigenen Sinn.“ Ihr Vermögen zu Mitgefühl und solidarischem Handeln ist geschwächt. Letzter Punkt des Vortrags: Wer war überhaupt Karl Heinz Haag? Der Kritischen Theoretiker wird als ein Mentor der Emanzipationsbewegung in den westdeutschen, späten 60er Jahren vorgestellt. Das Referat will ihn und diese Bewegung der Vergessenheit entreißen.
11. November 2025 | Joel Franke: Die Wiederkehr des Marxismus-Leninismus. Zur Reanimation eines Untoten durch rote Gruppen
Schien der Marxismus-Leninismus seit dem Zusammenbruch des Ostblocks auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet zu sein, erfährt er heute durch das verstärkte Auftreten roter Gruppen seine Wiedererweckung. Entstanden als stalinistische Kanonisierung von Marx, Engels und Lenin avancierte er zur Staatsideologie der UdSSR und des restlichen Ostblocks. Heute muss der Marxismus-Leninismus wieder als eine Legitimationstheorie für eine bestimmte Organisationsform, der Kaderpartei, herhalten. Doch während Kaderparteien kaum Erfolge in westlich industrialisierten Gesellschaften erzielen konnten, schmälert dies die gegenwärtige Beliebtheit des Marxismus-Leninismus genauso wenig wie deren grundsätzlicher Autoritarismus. Grund genug, sich den Marxismus-Leninismus einmal genauer anzuschauen.
Der Vortrag führt kritisch in den Marxismus-Leninismus ein, um dann gemeinsam dessen bleibende Beliebtheit zu diskutieren.
27. November 2025 | Redaktion Kunst, Spektakel & Revolution: Theorie und Kritik der Avantgarde
„Kunst, Spektakel & Revolution“ ist der Titel einer Veranstaltungsreihe in Weimar und eines Magazins, das seit 2010 in unregelmäßigen Abständen erscheint. KSR beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik und lotet aus, an welchen Punkten in der Geschichte (anti-)künstlerische und revolutionäre Bewegungen ineinander übergingen.
Im Juli ist die neunte Printausgabe von KSR erschienen. Das Heft beschäftigt sich mit dem Vermächtnis der historischen Avantgarden – also mit jenen Bewegungen wie Futurismus, DaDa oder Surrealismus, die die Institution der Kunst sprengen wollten, um die Potentiale der Kunst in das Vorhaben einer umfassenden Neugestaltung der Gesellschaft einfließen zu lassen. Diese Strömungen wollten die Wurzeln der Widersprüche des modernen Zeitalters freilegen und entwickelten dabei eine faszinierende Formensprache. Sie erreichten einen erstaunlichen Grad der Reflexion künstlerischer Mittel, formulierten einen heftigen Einspruch gegen den herrschenden Status quo und traten ein für das Neue. Dabei waren die Avantgarden selbst von einer Reihe von Widersprüchen geprägt – so revolutionär sie alle waren, bedeutete dies nicht immer Menschlichkeit in einem emanzipatorischen Sinne. Und ihr Unterfangen ist auf seltsam untote Weise in der Postmoderne präsent, die die Moderne nicht überwunden hat.
In der Heftvorstellung sollen einige Thesen zur Avantgarde vorgestellt und dabei ein Einblick ins Heft geliefert werden.
[Leider wurden die ersten Minuten des Vortrags nicht aufgezeichnet]